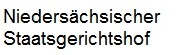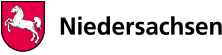60 Jahre Grundgesetz - ein Streifzug durch die Geschichte der Bundesrepublik
Professor Dr. Jörn Ipsen
Präsident des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs
Das Jahr 2009 ist das Jahr der Erinnerung. Zwar haben wir die Feiern zum 60. Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes glücklich hinter uns gebracht; aber auch der September ist voller geschichtsträchtiger Daten, an die die Erinnerung sich lohnt. Am 7. September 1949 traten der Deutsche Bundestag und der Bundesrat erstmals zusammen. Am 12. September wurde Theodor Heuss zum Bundespräsidenten gewählt. Drei Tage später folgte die Wahl Konrad Adenauers zum Bundeskanzler. Am 20. September wurde das erste Kabinett Adenauer gebildet, das von einer Koalition aus CDU/CSU, FDP und Deutscher Partei gestützt wurde. Einen Tag später wurde der Bundesregierung auf dem Petersberg von den Alliierten Hohen Kommissaren das Besatzungsstatut übergeben. Die Bundesrepublik war damit handlungsfähig geworden, stand aber nach wie vor unter Besatzungsherrschaft. Wer in diesem Jahr des Jahres 1949 gedenkt, darf nicht vergessen, dass der junge Staat aus den und auf den Trümmern des Deutschen Reiches gebildet wurde und die Wiederaufnahme in die Völkergemeinschaft erst schrittweise erfolgte. Das entscheidende Datum in diesem Prozess liegt ein dreiviertel Jahr später und wird bei den Erinnerungsfeiern zum Jahrestag der Gründung unseres Staates leicht vergessen. Es ist nämlich der 25. Juni 1950, der Tag, an dem nordkoreanische Truppen den 38. Breitengrad überschritten und große Teile Südkoreas einnahmen. Der folgende Korea-Krieg, in dem die USA auf Beschluss der UNO Truppen entsandten, veränderte die Lage auch in Mitteleuropa nachhaltig. Die USA drängten auf einen Verteidigungsbeitrag der Bundesrepublik, zu dem sich Adenauer Ende August – ohne Rücksprache mit seinem Kabinett – bereit erklärte. Damit war der Prozess der wirtschaftlichen und militärischen Westintegration eingeleitet, der gleichzeitig den Abbau der Besatzungsgewalt und die schrittweise Gewinnung der Souveränität bedeutete. Auch nach dem Beitritt der Bundesrepublik zur NATO und dem Abschluss des Deutschlandvertrags im Jahr 1955 verblieb es bei Vorbehalten der Alliierten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes, die erst am Vorabend der Deutschen Einigung – dem 3. Oktober 1990 – suspendiert wurden und nach Ratifikation des Zwei-plus-Vier-Vertrags außer Kraft traten.
Die Einbindung in das westliche Verteidigungsbündnis und die wirtschaftliche Verbindung mit anderen europäischen Staaten in Gestalt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war die Voraussetzung dafür, dass die Drei Mächte – Frankreich, Großbritannien und die USA – bereit waren, das Besatzungsstatut aufzuheben und der Bundesrepublik zunehmend einen gewissen außenpolitischen Spielraum zu gewähren. Der zeitlich enge Zusammenhang zwischen dem Zwei-plus-Vier-Vertrag, der die Vereinigung Deutschlands völkerrechtlich absicherte, und dem alsbald – nämlich im März 1992 – abgeschlossenen Vertrag von Maastricht, der die Grundlage für die Einführung einer gemeinsamen Währung war, zeigt deutlich, dass das Misstrauen gegenüber einem vereinten und wieder erstarkten Deutschland keineswegs überwunden war. Wir können heute mit Gewissheit sagen, dass weder 1952 – dem Jahr der sog. Stalin-Note – noch zu irgendeinem späteren Zeitpunkt die "Blockfreiheit" oder "Neutralität" eines wiedervereinigten Deutschlands eine Option gewesen wäre. Ein wiedervereinigtes Deutschland kam für die Westmächte – was schließlich auch Gorbatschow einsehen musste – nur als untrennbarer Bestandteil der Europäischen Gemeinschaft und NATO in Betracht.
Mit dem Grundgesetz galt in der Bundesrepublik die freiheitlichste Verfassung, die es in der Geschichte Deutschlands gegeben hat. Deutschland hatte den Anschluss an die große Verfassungsbewegung in Europa überhaupt erst spät gefunden. Die Paulskirchenverfassung, deren Grundrechte im Dezember 1848 als Bundesgesetz in Kraft traten, scheiterte unter den Kartätschen Preußens und ließ die bürgerliche Verfassungsbewegung auf lange Zeit erlahmen. Die Einheit Deutschlands war das Ergebnis dreier Kriege und des Bündnisses unter Fürsten. Die Reichsverfassung von 1871 war nach dem Willen Bismarcks ein Organisationsstatut und ließ nichts mehr von der Freiheitsbewegung, die die Revolution von 1848 beflügelt hatte, ahnen. Mit der Weimarer Reichsverfassung wurde zwar die Monarchie abgeschafft. Das Regierungssystem aber zeigte unverkennbare Spuren des überwundenen monarchischen Konstitutionalismus; freilich mit dem Unterschied, dass an die Stelle des Kaisers der Reichspräsident getreten war – wie man weiß, mit katastrophalen Folgen. Der ausgeprägte Grundrechtsteil der Weimarer Verfassung enthielt nach überwiegender Meinung vorwiegend "Programmsätze" für den Gesetzgeber, galt also nicht unmittelbar. Staat und Gesellschaft waren noch tief im monarchischen System verwurzelt. Mit der bekannten "Dolchstoß-Legende" wurde die Verantwortung der politischen und militärischen Eliten geleugnet und die Schuld für den verlorenen Krieg linksradikalen Kräften zugeschrieben. Der Staat von Weimar zerbrach schließlich an seinen inneren Gegensätzen und der vermeintliche Heilsbringer führte Deutschland endgültig in die Katastrophe. Der "Zivilisationsbruch" des nationalsozialisistischen Regimes, der menschliches Fassungsvermögen übersteigt, verhinderte jedoch, dass die Gründung der Bundesrepublik abermals von Geschichtsverfälschungen begleitet wurde. Es war vielmehr ein nicht zuletzt moralischer Neuanfang, der mit dem Grundgesetz ins Werk gesetzt wurde. Sichtbarstes Zeichen hierfür ist das an den Anfang gestellte Bekenntnis "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." Die Grundrechte gelten als die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung unmittelbar geltendes Recht, erlangten also – im Gegensatz zu Weimar – nicht erst durch den Gesetzgeber ihre Wirkung. Durch die sog. "Ewigkeitsklausel" wird sichergestellt, dass die Menschenwürde und die Grundsätze der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaatlichkeit und des Bundesstaates durch Verfassungsänderungen nicht berührt werden dürfen.
Das Grundgesetz zeigt damit ein gegenüber der Weimarer Verfassung deutlich verändertes Menschenbild. Jeder Mensch hat seine eigene Würde und dies bedeutet, dass ihm – auch und insbesondere – gegenüber dem Staat Rechtssubjektivität zukommt. Der Bürger ist also nicht länger Untertan einer mehr oder weniger unbegrenzten Staatsgewalt; er tritt dem Staat als Träger eigener Rechte – als Rechtssubjekt – gegenüber. Der Staat wiederum ist kein "höheres Wesen", sondern ein Verband, der mit demokratischer Legitimation seiner Bürger ausgestattet öffentliche Aufgaben erfüllt. In einem in seiner Tradition obrigkeitsstaatlich ausgerichteten Land musste sich ein solches Bewusstsein erst durchsetzen. Die Verfassung ist zwar die rechtliche Grundordnung eines Staates, vollzieht sich indes nicht von selbst. Ihre Wirksamkeit erlangt sie nur durch die Organe, die sie zu vollziehen und zu beachten haben, nicht aber zuletzt durch die Bürger, die sich auf sie berufen. Wenn Goethe Faust im zweiten Teil der Tragödie sagen lässt "Nur der verdient die Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss", so ist damit ein Wesenszug auch jeder freiheitlichen Verfassung getroffen: Freiheit muss von Menschen in Anspruch genommen, gelebt, verteidigt, eben: "erobert" werden. Wer Einschränkungen seiner Freiheit klaglos hinnimmt, wird sie bald einbüßen. Das Grundgesetz schuf mit der Rechtsweggarantie eine Möglichkeit für den Bürger, sich gegen jede Verletzung seiner Rechte durch Anrufung der Gerichte zur Wehr zu setzen. Die vollziehende Gewalt steht also stets unter gerichtlicher Kontrolle, was sich freilich im Bewusstsein der Bürger erst durchsetzen musste. Ein entscheidender Anteil an der Durchsetzung der Freiheitsrechte kam dem neu errichteten Bundesverfassungsgericht zu, zu dem der Zugang auch für den Bürger durch die Verfassungsbeschwerde eröffnet wurde. Das Bundesverfassungsgericht war insofern nicht nur ein "Staatsgerichtshof", der Streitigkeiten zwischen den einzelnen Staatsorganen entschied. Seine Aufgabe war – und ist – auch der Schutz der Grundrechte auf Anrufung der Bürger selbst. Dass jährlich rund 6000 Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe eingehen, weist auf das große Vertrauen hin, dass dem Bundesverfassungsgericht bei seiner Aufgabe durch die Bevölkerung entgegengebracht wird.
Es wäre nun ein Irrtum zu meinen, dass mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes sich gewissermaßen schlagartig bei Bürgern wie Staatsorganen ein völlig neues Rechtsbewusstsein eingestellt hätte. Die "Konstitutionalisierung" des Rechts war vielmehr ein langer, nicht selten zäher Prozess. Lassen Sie mich dies an drei Beispielen verdeutlichen:
- Anlässlich der Woche des deutschen Films im Jahr 1950 richtete der Vorsitzende des Hamburger Presseclubs, Erich Lüth, einen Appell an Filmtheaterbesitzer und Verleiher, den Film des Regisseurs Veith Harlan "Unsterbliche Geliebte" nicht in ihr Programm aufzunehmen und forderte gleichzeitig das Publikum auf, diesen Film nicht zu besuchen. Harlan war Schöpfer nationalsozialistischer Propagandafilme, unter anderem des Films "Jud Süß", der im nationalsozialistischen Deutschland den Antisemitismus erheblich verstärkte. Lüth wurde vom Landgericht Hamburg bei Androhung einer hohen Geldbuße zur Unterlassung dieser Äußerungen verurteilt. Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil des Gerichts auf und erklärte, dass Lüths Äußerungen vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt seien, weil sie nur einen Appell an die eigene Urteilsbildung der angesprochenen Kreise enthielten. Das "Lüth-Urteil" stellt eine Wegmarke in der Dogmatik von Freiheitsgewährleistung und –einschränkung dar und ist unverändert bedeutsam.
- Im Herbst 1962 veröffentlichte das Magazin "Der Spiegel" einen Bericht "Bedingt abwehrbereit", in dem Mängel bei dem Aufbau der Bundeswehr gerügt wurden. Gegen Herausgeber und Redakteure des "Spiegel" wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats eingeleitet, mehrere Personen – darunter der Herausgeber Rudolf Augstein – in Untersuchungshaft genommen und Redaktions- und Verlagsräume wochenlang durchsucht. Ein Hauptverfahren vor dem damals zuständigen Bundesgerichtshof fand nicht statt. Die Verfassungsbeschwerde wurde zwar zurückgewiesen, in der Sache allerdings differenzierte das Bundesverfassungsgericht zwischen dem Landesverrat zugunsten einer feindlichen Macht und der Aufdeckung von Mängeln, wie sie der "Spiegel" vorgenommen hatte. Das "Spiegel-Urteil" darf deshalb im Ergebnis als Bestätigung der Pressefreiheit gelten.
- Die Illustrierte "Stern" veröffentlichte vor einigen Jahren Anzeigen einer italienischen Textilfirma mit sog. "Schock-Werbung", auf der Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, Aids-Erkrankung und andere gesellschaftliche Probleme thematisiert wurden. Der Bundesgerichtshof verbot diese Werbung mit der Begründung, dass es gegen die Grundsätze des lauteren Wettbewerbs verstoße, wenn aus dem Leiden der Menschen Profit gezogen würde. Das Bundesverfassungsgericht hob auch dieses Urteil auf, weil es der Pressefreiheit den Vorrang einräumte.
Es wäre indes naiv zu glauben, dass die Gewährleistung grundrechtlicher Freiheiten allein die Bundesrepublik in ihren Anfängen stabilisiert hätte. Ernst-Wolfgang Böckenförde hat zutreffend festgestellt, dass der freiheitliche Rechtsstaat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Hierzu gehört nicht zuletzt ein Engagement der Bürger, das sich – auch, aber nicht nur – in der Wahlbeteiligung äußert, die in den ersten Jahrzehnten bei Bundestagswahlen bis zu 90 % betrug. Entscheidend war indes eine beispiellose Entwicklung der Wirtschaft – das bekannte "Wirtschaftswunder" – die die 50er und beginnenden 60er Jahre kennzeichnete. Hinzu kam die 1957 ins Werk gesetzte Rentenreform – die Einführung der "dynamischen Rente" –, die auch ältere Menschen an der Aufwärtsentwicklung teil haben ließ. Die Entwicklung des Sozialstaats ist deshalb in der Bundesrepublik von der Festigung der Demokratie nicht zu trennen. Eine weniger dynamische Wirtschaftsentwicklung, wie sie sich Mitte der 60er Jahre abzeichnete, rief sogleich radikale Kräfte auf den Plan und führte nach Bildung der Großen Koalition im Jahr 1966 zu weitreichenden Verfassungsänderungen.
Man sollte sich die Regierungszeit Konrad Adenauers, der 1963 vom Amt des Bundeskanzlers zurücktrat, nicht als reine Idylle vorstellen. Die CDU entwickelte sich allerdings zur beherrschenden Kraft und errang bei den Wahlen 1957 die absolute Mehrheit der Stimmen und Mandate. Einen nicht unerheblichen Ansehensverlust erlitt Adenauer, als er 1959 von seiner zunächst erklärten Kandidatur zum Amt des Bundespräsidenten zurücktrat. Der Grund hierfür war gleichermaßen politisch wie verfassungsrechtlich einleuchtend. Zunehmend stellte sich heraus, dass der Wirtschaftsminister Ludwig Erhard – der "Vater" des Wirtschaftswunders – die größten Chancen für die Nachfolge Adenauers als Bundeskanzler besaß. Adenauer war indes von der mangelnden Eignung Erhards für dieses Amt zutiefst überzeugt, hätte ihn aber als Bundespräsident hierfür vorschlagen müssen. Wenn er sich diesem Vorschlag verweigert hätte, hätte nach den Vorschriften des Grundgesetzes der Bundestag in einem zweiten Wahlgang Erhard wählen können, ohne an einen Vorschlag gebunden zu sein. Damit wäre die Staatskrise perfekt gewesen. Adenauer hielt sich in seinem Amt weitere vier Jahre, zunehmend allerdings unter Schwierigkeiten. Bei den Bundestagswahlen 1961 sprach sich die FDP zwar für eine Koalition mit der CDU/CSU, aber ohne Adenauer aus und erreichte mit dieser Strategie einen erheblichen Stimmengewinn. Die SPD hatte sich mittlerweile von ihren marxistischen Wurzeln weitgehend verabschiedet und trat in Gestalt des "Godesberger Programms" zunehmend als moderne Volkspartei in Erscheinung. Adenauer disziplinierte bei den Koalitionsverhandlungen im Jahr 1961 die FDP dadurch, dass er auch eine Koalition mit der SPD als möglich darstellte, musste allerdings das Datum für seinen Rücktritt – Herbst 1963 – bereits festlegen. Die Regierung Erhard blieb eine Episode, obwohl der neue Bundeskanzler 1965 einen überwältigenden Wahlsieg errang. Er konnte sich indes nur noch ein Jahr an der Regierung halten. Nach Ausscheiden der FDP aus der Koalition bildete die CDU/CSU mit der SPD zusammen die erste "Große Koalition" unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, die bis 1969 bestand und während ihrer Regierungszeit wesentliche Änderungen des Grundgesetzes vornahm. Erst 1969 – nach 20 Jahren ununterbrochener Herrschaft der CDU/CSU – trat ein Regierungswechsel ein, in dem nämlich die SPD mit der FDP unter Willy Brandt eine Regierungskoalition bildete. Die SPD/FDP-Koalition wurde durch das Wahlergebnis ermöglicht, aber nicht erzwungen. Die CDU/CSU errang seinerzeit 46,8 %, die SPD 42,7 % und die FDP 5,8 % der Stimmen. Die programmatischen Gemeinsamkeiten zwischen SPD und FDP hatten indes zugenommen; überdies war im Frühjahr 1969 der Kandidat der SPD für das Amt des Bundespräsidenten Gustav Heinemann auch mit Stimmen der FDP zum Bundespräsidenten gewählt worden. Das Jahr 1969 stellt insofern eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik dar, als ein Politikwechsel bis dahin unbekannten Ausmaßes stattfand. Dies betraf allerdings – entgegen den Ankündigungen des Bundeskanzlers – in erster Linie die Außenpolitik, insbesondere das Verhältnis zur Sowjetunion. Die "neue Ostpolitik" der Regierung Brandt/Scheel hat zu Verträgen mit der Sowjetunion, Polen, der Tschechoslowakei und DDR geführt und eine Phase der Entspannung in Mitteleuropa eingeleitet. Nachdem ein Versuch, Bundeskanzler Brandt 1972 durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen, gescheitert war, regierte die Koalition – ab 1974 unter Bundeskanzler Helmut Schmidt bis zu dessen Sturz 1982 weiter. Bundeskanzler Helmut Kohl blieb bis 1998 an der Macht und wurde von Gerhard Schröder abgelöst, der sieben Jahre Bundeskanzler in einer Koalition mit den Grünen blieb. Die Entwicklung seit dem Jahr 2005 kennen Sie und erwarten – wie ich – gespannt die Ergebnisse der Bundestagswahlen am 26. September. Der knappe Überblick möge deutlich machen, warum das Jahr 1969 für die weitere Entwicklung der Demokratie in Deutschland – auch abgesehen von der von der Regierung Brandt/Scheel verfolgten Politik – so bedeutsam war. Der Demokratie ist der periodische Wechsel von Regierung und Opposition wesenseigen. Wo die gleichen politischen Kräfte auf Dauer regieren, droht die Gefahr programmatischer und personeller Verkrustung. Insofern ist es für die demokratische Staatsform essentiell, dass der Regierungswechsel nicht nur theoretische Möglichkeit bleibt, sondern praktiziert wird. Großbritannien, die Beneluxstaaten und die skandinavischen Demokratien bieten hierfür gute Beispiele.
Die bedeutsamste Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik ist zweifelsfrei das Jahr 1989 – genauer: Der 9. November, der Tag, an dem die Mauer fiel und die innerdeutsche Grenze durchlässig wurde. Niemand hatte dieses Ereignis vorhergesehen – weder Politiker noch Geheimdienste. Noch heute muss es erstaunen, dass trotz aller Bekenntnisse zur Deutschen Einheit, die die politische Rhetorik beherrschten, man sich in der Bundesrepublik mit der deutschen Teilung abgefunden und sich im westdeutschen Teilstaat gut eingerichtet hatte. Die Öffnung der Mauer traf die deutsche Politik deshalb unvermittelt und mit Wucht. Zwar stellen die Ereignisse am Abend des 9. November 1989 nur den Kulminationspunkt einer längeren Entwicklung dar, in der die Bürgerrechtsbewegung zunehmend an Selbstbewusstsein gewann und der Repressionsapparat der DDR sich ihr gegenüber zunehmend als hilflos erwies. Dem Präsidenten der DDR–Volkskammer Horst Sindermann wird der Ausspruch zugeschrieben: "Alles hatten wir erwartet, auf alles waren wir vorbereitet; nur nicht auf Kerzen und Gebete". Eine nicht geringe Rolle spielte die Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze und das sog. "Paneuropäische Picknick", das Hunderten von DDR-Bürgern die Flucht in die Bundesrepublik ermöglichte. Anlässlich der pompösen Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR wurde deutlich, dass die sowjetische Führung unter Gorbatschow das Regime nicht länger zu stützen bereit war und den Einsatz militärischer Gewalt gegen Demonstranten ausschloss.
Für die Ereignisse seit dem 9. November 1989 ist der Begriff der "Wende" gebräuchlich geworden, der von dem interimistischen SED-Chef Egon Krenz geprägt worden ist. Es hat sich indes staatstheoretisch um eine Revolution – und zwar eine friedliche Revolution – gehandelt. Das SED-Regime wurde gestürzt, der Repressionsapparat der Staatssicherheit entmachtet und die Verfassung geändert. Mit den Wahlen vom 18. März 1990 und dem Sieg der "Allianz für Deutschland" übernahmen neue politische Kräfte die Regierung und verfolgten zielstrebig die Deutsche Einheit. Die Jahreswende 1989/1990 ist deshalb für die deutsche Geschichte insgesamt ein so wichtiger Abschnitt, weil Deutsche zum ersten Mal aus eigener Kraft die ersehnte Freiheit errungen hatten. Wie eingangs erwähnt war die März-Revolution von 1848 und der mit ihr unternommene Versuch, eine konstitutionelle Monarchie zu errichten, im folgenden Jahr gescheitert. Die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz sind nicht Ergebnisse von Revolutionen, sondern verlorener Kriege gewesen. Der Sturz des SED-Regimes durch die Bevölkerung der DDR unter der Parole "Wir sind das Volk" erfüllt alle Voraussetzungen eines revolutionären Umbruchs. Freilich hat es sich um eine friedliche Revolution gehandelt, die allerdings auch zeigte, wie brüchig das Regime inzwischen war.
Es ist bemerkenswert, wie gegenwärtig von bestimmten politischen Kräften versucht wird, im Nachhinein die DDR als eine Art sozialistischer Idylle zu zeichnen, in der es zwar keinen Reichtum Einzelner, aber auch keine Arbeitslosigkeit gab. Symptomatisch ist auch die jüngere Diskussion darüber, ob die DDR ein "Unrechtsstaat" gewesen ist. Der Hintergrund solcher Verzeichnungen und Umdeutungen der Geschichte ist leicht zu erkennen: Das individuelle Schicksal ist mit der Geschichte der DDR verbunden und niemand mag zugeben, gewissermaßen umsonst gelebt zu haben. Die hiervon Betroffenen verdienen jedes menschliche Verständnis, weil sie ihr Schicksal nicht selbst haben bestimmen können. Anders verhält es sich mit jenen politischen Kräften, die gegenwärtig an Bedeutung zunehmen und deren Wortführer nicht selten in das Regime verstrickt waren. Der Prozess der Vereinigung vollzog sich mit einer Rasanz, die Ende des Jahres 1989 niemand für möglich gehalten hätte. Der Satz "Wir sind das Volk" wurde bald in den Leitspruch "Wir sind ein Volk" umgewandelt und nach den März-Wahlen 1990 war eindeutig, wohin die Entwicklung zielte.
Lassen Sie mich kurz in Erinnerung rufen, dass es für die deutsche Einigung zwei unterschiedliche – vom Grundgesetz vorgezeichnete – Wege gab. Die Beitrittsmöglichkeit war im Falle des Saarlandes genutzt worden, das ab dem 1. Januar 1957 in die Bundesrepublik eingegliedert worden war. Andererseits eröffnete das Grundgesetz die Möglichkeit, durch das Volk eine gesamtdeutsche Verfassung zu beschließen. Die beiden deutschen Staaten hätten also eine neue Verfassung ausarbeiten müssen, die Gegenstand einer Volksabstimmung geworden wäre und für das vereinigte Deutschland gegolten hätte. Letzterer Weg wurde in der öffentlichen Diskussion 1990 durchaus befürwortet, nicht zuletzt, um vermeintliche sozialistische Errungenschaften des DDR-Staates in ein vereinigtes Deutschland herüberzuretten. Er erwies sich aber sehr schnell als illusorisch, weil nach Öffnung von Mauer und Grenze eine Abwanderungsbewegung in einem solchen Ausmaß einsetzte, die nur durch eine rasche Einführung der D-Mark in der DDR und die Angleichung der Lebensverhältnisses aufgehalten werden konnte. Bereits am 1. Juli 1990 trat der Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft, dem alsbald der Einigungsvertrag folgte.
Es scheint zu den Eigenschaften der Deutschen zu gehören, sich über ein historisch glückhaftes Ereignis wie die Vereinigung nicht dauerhaft freuen zu können. Nach dem rauschhaften Erleben des Mauerfalls und der Vereinigung am 3. Oktober 1990 meldeten sich alsbald wieder Kritiker zu Wort und gewannen jene Kräfte in den neuen Bundesländern Zulauf, die das alte Regime gestützt hatten. Eine nüchterne Bilanz zeigt ein völlig anderes Bild. Der Einigungsvertrag ist ein staatsrechtliches Meisterwerk gewesen, das die Grundlage für die Zusammenführung zweier völlig unterschiedlicher Rechts- und Gesellschaftssysteme ermöglichte. Dass hierbei Schwierigkeiten auftraten, die nicht erwartet worden waren, steht außer Zweifel. Allerdings resultierten – und resultieren – sie nicht zuletzt aus dem Umstand, dass die Wirtschaft der DDR sich in einem katastrophalen Zustand befand und die Infrastruktur überhaupt erst aufgebaut werden musste. Wer heute die frühere innerdeutsche Grenze überschreitet, kann sich ständig davon überzeugen, was in diesen 20 Jahren geleistet worden ist.
Es ist kein historischer Zufall, dass im Gefolge der deutschen Einigung die Bemühungen um die europäische Integration verstärkt wurden und im Vertrag von Maastricht ihren Ausdruck fanden. 1955 hatte die Bundesrepublik ihre Souveränität im Gegenzug gegen die Westintegration – Beitritt zur NATO und zur westeuropäischen Union – erlangt. Nachdem die alliierten Vorbehaltsrechte mit der Vereinigung erloschen waren – wobei an dieser Stelle durchaus des Widerstands Frankreichs und Großbritanniens gegen die Vereinigung gedacht sei –, zielten die gemeinsamen Bemühungen auf eine noch stärkere europäische Integration in Gestalt der Wirtschafts- und Währungsunion ab. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, hat aber in Gestalt des Vertrags von Lissabon kräftige Impulse erhalten. Es bedarf freilich der Erwähnung, dass ausgerechnet das Bundesverfassungsgericht gegenüber dem durch das Grundgesetz vorgegebenen Prozess der europäischen Einigung zunehmend Bedenken anmeldet.
Ich möchte meinen Streifzug durch die Geschichte der Bundesrepublik nicht ohne ein kurzes Resümee abschließen. In der Bundesrepublik hat sich im Laufe von sechs Jahrzehnten nicht nur die Demokratie als Regierungssystem verfestigt und bewährt; es hat sich auch eine Bürgergesellschaft entwickelt, die den Vergleich mit anderen Ländern nicht zu scheuen braucht. Der deutsche Obrigkeitsstaat und der ihm entsprechende Untertanengeist gehören der Vergangenheit an. In jüngster Zeit mehren sich auch die Anzeichen dafür, dass das Angstsyndrom – auch im Ausland als "the german angst" –, nämlich die überschießende Reaktion auf wirkliche und vermeintliche Krisen, im Rückgang begriffen ist.