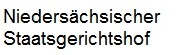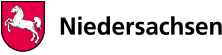Festvortrag des Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs
Professor Dr. Jörn Ipsen
Präsident des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs
Die Entwicklung der Niedersächsischen Verfassung
Vortrag, gehalten aus Anlass des 60jährigen Jubiläums
der Niedersächsischen Verfassung am 20. Mai 2011
im Plenarsaal des Niedersächsischen Landtags
Der Gründung des Landes Niedersachsen ist in diesem Saal am 11. Mai 2007 in würdiger Form gedacht worden. Neben den Repräsentanten des Landes hielt der Speaker des Britischen Unterhauses einen Vortrag und rief damit in Erinnerung, dass Niedersachsen seine Entstehung einem Rechtsakt der britischen Besatzungsmacht – der bekannten „OrdinanceNo. 55“ – verdankt. Der Staat Niedersachsen war damit geboren, hatte er aber auch eine Verfassung? Zwar enthielt die Anordnung der Militärregierung einige Bestimmungen über die Ausübung der Staatsgewalt; so sollte die vollziehende Gewalt von einem Ministerium ausgeübt werden, dessen Vorsitzender die Bezeichnung „Ministerpräsident“ führte. Dieser und die übrigen Mitglieder des Ministeriums wurden vom Militärgouverneur ernannt. Ferner war bestimmt, dass das Land Niedersachsen eine gesetzgebende Körperschaft errichtete, deren Zusammensetzung und Mitglieder einstweilen durch den Militärgouverneur bestimmt wurde. Diese rudimentären Bestimmungen lassen sich jedoch nicht als „Verfassung“ ansprechen, sondern waren ein besatzungsrechtlicher Rahmen für die wiederentstehende deutsche Staatlichkeit.
Anders könnte es sich mit dem „Gesetz zur vorläufigen Ordnung der Niedersächsischen Landesgewalt“ verhalten, das der von der Militärregierung ernannte Landtag beschlossen hatte und das im Februar 1947 in Kraft trat. Dieses Gesetz enthielt in insgesamt 13 Paragraphen Bestimmungen über den Landtag und seine Gesetzgebungstätigkeit, über die „Staatsregierung“ und ihre Befugnisse und die Fortgeltung der Rechtsvorschriften der früheren Länder Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe. Überdies war bestimmt, dass die Rechtspflege durch unabhängige, nur den Gesetzen unterworfene Gerichte ausgeübt wurde. Seine Geltung sollte bis zum 31. Dezember 1947 begrenzt sein.
Das Gesetz wird zwar gelegentlich als „Notverfassung“ bezeichnet, weist indessen weder in seinem Entstehungsmodus noch in seinem Rang die Kennzeichen auf, die den Begriff einer „Verfassung“ rechtfertigen würden. Das „Gesetz zur vorläufigen Ordnung der Niedersächsischen Landesgewalt“ wurde fünfmal verlängert, bis schließlich die Befristungsregelung gestrichen wurde. Gewissermaßen in seinem Windschatten vollzog sich eine höchst bemerkenswerte Entwicklung, der ich mich zunächst widmen möchte.
Der von der britischen Militärregierung ernannte Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf – vormals Ministerpräsident des LandesHannover – zog sich im Sommer 1947 mit einigen Beratern auf die Insel Neuwerk zurück und erarbeitete den Entwurf einer – zunächst 98 Artikel umfassenden – Verfassung. Eine überarbeitete Fassung des Entwurfs liegt vor, ist aber nicht genau zu datieren. Sie dürfte aus dem Herbst 1947 stammen und stellte eine leicht gekürzte – aus nunmehr 92 Artikeln bestehende – Fassung des ersten Neuwerk-Entwurfs dar.
Kopf legte den Entwurf einer „Vollverfassung“ vor, der im ersten Teil Grundsatzbestimmungen für das Land Niedersachsen, im zweiten Teil „Der Mensch und seine Ordnungen“, Grundrechte, Grundpflichten, institutionelle und Institutsgarantien enthielt, während im dritten Teil „Der Staat“ die Staatsorganisation geregelt wurde. Als Staatsorgane waren der Landtag, die Staatsregierung und ein „Landesrat“ vorgesehen, der aus 33 Mitgliedern – den sogenannten „Landesältesten“ – bestehen sollte, die mindestens 50 Jahre alt seien mussten und auf Lebenszeit gewählt werden sollten. Neben die demokratisch legitimierten Organe Landtag und Staatsregierung wäre damit ein korporatistisch angelegtes drittes Staatsorgan getreten, das Anklänge an den Senat der Verfassung des Freistaats Bayern aufgewiesen hätte. Dem Landesrat sollte ein Einspruchsrecht gegenüber vom Landtag beschlossenen Gesetzen zustehen. Dieser Einspruch konnte mit absoluter Mehrheit der Landtagsmitglieder überstimmt werden.
Der Verfassungsentwurf Hinrich Wilhelm Kopfs gibt – ebenso wie der Entwurf eines Niedersächsischen Staatsgrundgesetzes der Deutschen Partei vom 9. Dezember 1947 – reichen Beleg dafür, dass in Niedersachsen zunächst die Zeichen auf eine „Vollverfassung“ hindeuteten und dieser Trend erst durch die Beratungen zum Grundgesetz und dessen schließliches Inkrafttreten unterbrochen wurde.
Der Entwurf Kopfs war auch innerhalb der SPD umstritten, traf insbesondere bei Kurt Schumacher – dem Bundesvorsitzenden der SPD – auf scharfe Ablehnung, so dass Kopf den Entwurf zurückzog. Obwohl im Landtag bis Ende des Jahres 1947 mehrere Entwürfe für eine Niedersächsische Verfassung eingebracht worden waren, trat die Verfassungsdiskussion alsbald in den Schatten der Beratungen eines Bonner Grundgesetzes, wofür nicht zuletzt die mehrmalige Verlängerung des Gesetzes zur vorläufigen Ordnung der Niedersächsischen Landesgewalt spricht.
Der am 26. Mai 1950 von der Landesregierung vorgelegte Entwurf einer „Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung“ unterschied sich prinzipiell von allen vorhergehenden Verfassungsentwürfen, insbesondere auch vom Neuwerk-Entwurf. Zwar wurde in Art. 1 des Entwurfs Niedersachsen als „republikanischer, demokratischer und sozialer Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland“ bezeichnet und in Art. 2 Abs. 1 Satz 1 bestimmt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgehe. Damit war klargestellt, dass das Land Niedersachsen als Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland eigene Staatlichkeit für sich in Anspruch nahm. Im Übrigen hinterließ der Neuwerk-Entwurf kaum Spuren. Der Grundrechtsteil war ersatzlos gestrichen worden, so dass der Zweite Teil „Aufbau der Staatsgewalt“ nur aus organisatorischen Bestimmungen bestand. Der Dritte Teil beschränkte sich auf Übergangs- und Schlussbestimmungen.
Der Entwurf war geprägt durch eine starke Stellung der „Staatsregierung“, die ihre Ursache in der auch in der SPD verbreiteten Skepsis gegenüber dem Parlamentarismus hatte. Der Ministerpräsident wurde vom Landtag mit absoluter Mehrheit gewählt, wobei auch die Staatsregierung zu ihrer Amtsübernahme des Vertrauens des Landtags bedurfte. Der Landtag konnte dem Ministerpräsidenten jedoch nicht das Misstrauen aussprechen. Unter dem Signum „Regierung auf Zeit“ war vielmehr für ein Höchstmaß an Stabilität der einmal gewählten bzw. bestätigten Regierung Sorge getragen worden. Vorgesehen war lediglich, dass der Landtag mit der Mehrheit aller Abgeordneten seine Auflösung beschließen konnte. Sofern er dies tat und Neuwahlen stattfanden, musste der Ministerpräsident zurücktreten, sobald der neugewählte Landtag zusammentrat. Die Möglichkeit des Regierungssturzes in der laufenden Legislaturperiode war dem Landtag demgegenüber verwehrt. Insofern bedeutete die euphemistisch als „Regierung auf Zeit“ bezeichnete Regelung einen Rückschritt gegenüber dem im Neuwerk-Entwurf vorgesehenen – wenn auch gestreckten – konstruktiven Misstrauensvotum.
Parlamentsskepsis sprach auch aus dem Einspruchsrecht des „Staatsministeriums“ gegen vom Landtag beschlossene Gesetze. Der Regierungsentwurf hatte damit in der Sache das im Neuwerk-Entwurf dem Landesrat zukommende Vetorecht übernommen, dieses aber dem Staatsministerium – d.h. der als Organ auftretenden Landesregierung – zugeordnet. Die Regierung erhielt damit partiell die Funktion einer zweiten Kammer, weil nach Einlegung des Einspruchs eine Art Vermittlungsverfahren stattzufinden hatte, nach dessen Abschluss erst eine erneute Abstimmung mit möglicher Zurückweisung des Einspruchs erfolgen konnte. Einen gewissen Einfluss des Landtags auf die Regierungsbildung versprach die – schon im Neuwerk-Entwurf vorgesehene – Bestimmung, dass die Staatsregierung zu ihrer Amtsübernahme des Vertrauens des Landtags bedurfte. Im Unterschied zum Neuwerk-Entwurf war auch zur Berufung oder Entlassung eines Staatsministers nach dem Amtsantritt der Staatsregierung die Zustimmung des Landtages erforderlich.
Der Staatsgerichtshof erfuhr im Regierungsentwurf nur eine knappe Regelung im Abschnitt über „Die Rechtspflege“. Verfassung und Verfahren waren dem Gesetz überlassen. Geregelt war lediglich, dass der Staatsgerichtshof in Organstreitigkeiten und im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle entschied. Im Unterschied zum Neuwerk-Entwurf, der den Staatsgerichtshof ausdrücklich als „Hüter der Verfassung“ bezeichnete und ihm weitere Kompetenzen zuwies, wurden die Verfassungsstreitigkeiten innerhalb Niedersachsens dem Bundesverfassungsgericht übertragen. Die Errichtung eines eigenen Staatsgerichtshofs war letztlich – so die Begründung des Regierungsentwurfs – von der Erwägung getragen worden, dass sich der Kostenaufwand in „erträglichen Grenzen“ halten ließe, da der Umfang der Rechtsprechung es voraussichtlich gestatte, die Richter nebenamtlich zu beschäftigen. Diese Voraussage sollte sich während der nächsten 61 Jahre als zutreffend erweisen und auch in Zukunft wird sich an der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitglieder des Staatsgerichtshofs nichts ändern.
Die parlamentarische Behandlung der Regierungsvorlage war durch die Besonderheit gekennzeichnet, dass die Professoren Werner Weber (Universität Göttingen) und Wolfgang Abendroth(Hochschule Wilhelmshaven) am 15. November 1950 im Plenum des Landtags gutachtliche Stellungnahmen abgaben und trotz Verschiedenheit ihrer politischen Positionen übereinstimmend zu einem positiven Urteil gelangten. Weber stellte dem Verfassungsentwurf vor allem deshalb ein günstiges Zeugnis aus, weil er auf eine Betonung der Eigenstaatlichkeit des Landes Niedersachsen verzichtete und sich insofern von den „Prunkverfassungen“ der Länder Süd- und Südwestdeutschlands unterschied. Der Regierungsentwurf kam insofern dem einerseits etatistischen, andererseits unitarischen Grundverständnis Webers entgegen, nachdem die Länder „in keinem entscheidenden Punkte mehr als Staaten, sondern nur als gliedhafte Körperschaften höherer Ordnung begreifbar“ sein sollten. Wurde aber die Staatsqualität der Länder als solche in Frage gestellt, musste sich auch die „Verfassungsfrage“ schlechthin stellen und mussten sich jegliche Reminiszenzen an „echte“ Staatsverfassungen als hypertroph darstellen. Als typisch will erscheinen, dass Weber den Umstand lobend hervorhob, dass das Land Schleswig-Holstein seine Verfassung lediglich als „Landessatzung“ bezeichnet hatte.
Im Laufe der Beratungen wurden eine Reihe von Vorschriften des Regierungsentwurfs modifiziert bzw. neue Bestimmungen hinzugefügt. Anders als im Entwurf enthielt Art. 1 der Vorläufigen Verfassung die Aussage, dass das Land Niedersachsen aus den ehemaligen Ländern Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe hervorgegangen sei. Für die Flagge wurden – auch dies im Unterschied zum Regierungsentwurf – die Farben Schwarz, Rot und Gold mit dem Landeswappen bestimmt und damit der Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland symbolischer Ausdruck verliehen. Das Verhältnis der – nunmehr als „Landesregierung“ bezeichneten – Regierung zum Landtag wurde in der Weise modifiziert, dass wenn eine Bestätigung der Regierung innerhalb von 21 Tagen nach dem Zusammentritt des Landtags oder dem Rücktritt der Landesregierung nicht zustande kam, der Landtag über seine Auflösung zu beschließen hatte. Sofern eine Auflösung nicht beschlossen wurde, sollte unverzüglich eine neue Wahl des Ministerpräsidenten stattfinden, bei der gewählt war, wer die meisten Stimmen erhielt. Einer Bestätigung der Regierungsbildung durch den Landtag bedurfte es in diesem Falle nicht. Diese Bestimmungen sind zu Beginn des Jahres 1976 zur Anwendung gelangt, als Ernst Albrecht zwar zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, innerhalb der Drei-Wochen-Frist aber keine Kabinettsliste vorlegte. Da der Landtag auf seiner Sitzung vom 6. Februar 1976 seine Auflösung ablehnte und Albrecht bei der erneuten Wahl sogar die absolute Mehrheit der Stimmen im Landtag erhielt, konnte er eine Regierung bilden, ohne der Bestätigung des Landtags zu bedürfen. Doch damit greife ich der weiteren Entwicklung vor.
Bemerkenswerterweise enthielt die Vorläufige Niedersächsische Verfassung keine Vorschrift darüber, welcher Mehrheit sie zu ihrer Verabschiedung bedurfte. Eine Volksabstimmung erschien wegen entsprechender Bedenken der Britischen Militärregierung von vornherein ausgeschlossen. Aus den Bestimmungen über die Verfassungsänderung wurde geschlossen, dass der Erlass der Verfassung der gleichen Mehrheit bedürfe. Letztlich stellte sich die Frage des Mehrheitserfordernisses nicht, weil die Vorläufige Niedersächsische Verfassung bei der Schlussabstimmung am 3. April 1951 mit 107 Ja-Stimmen gegenüber 28 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen wurde. Von der gesetzlichen Mitgliederzahl von 148 Abgeordneten waren 10 Abgeordnete abwesend. Damit war nicht nur die für Verfassungsänderungen vorgesehene Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten – nämlich 92 Stimmen –, sondern auch zwei Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl – nämlich 99 Stimmen – erreicht.
Die Vorläufige Niedersächsische Verfassung ist am 1. Mai 1951 in Kraft getreten. Sie ist bis zum 1. Juni 1993 in Kraft geblieben. Während ihrer 42jährigen Geltungsdauer hat es insgesamt zwölf Änderungsgesetze gegeben. Das Achte Gesetz zur Änderung der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung vom 20. April 1970 betraf Art. 6 NV und beendete eine „Verfassungskrise“. In seiner Ursprungsfassung bestimmte Art. 6 Abs. 1 Satz 2 VNV, dass die Wahlperiode mit dem Ablauf der Wahlperiode des alten Landtags begann, im Falle der Auflösung mit dem Tage der Neuwahl. Da der Landtag spätestens am 30. Tag nach Beginn der Wahlperiode zusammentreten musste, ergab sich die Möglichkeit einer parlamentslosen Zeit, während derer ein ständiger Ausschuss die Rechte des Landtags gegenüber der Landesregierung wahrzunehmen hatte. Die Änderung bestand in der Ergänzung des Art. 6 VNV um einen dritten Satz, nach dem die Wahlperiode im Falle der Auflösung 60 Tage nach dem Beschluss des Landtags endete. Insofern bestand bei entsprechender Terminierung die Möglichkeit, die Neuwahlen so rechtzeitig anzusetzen, dass der neugewählte Landtag zusammentreten konnte, ohne dass eine parlamentslose Zeit entstand.
Die „Verfassungskrise“ der Jahre 1969/70 beruhte auf einer veränderten politischen Konstellation. Gewissermaßen im Vorgriff auf den Bund war in Niedersachsen 1965 eine Große Koalition aus SPD und CDU unter Ministerpräsident Georg Diederichs gebildet worden. Nachdem die Große Koalition auf Bundesebene nach der Wahl 1969 nicht erneuert wurde und an ihre Stelle eine aus SPD und FDP gebildete Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt trat, waren Rückwirkungen auf die politische Situation in Niedersachsen unvermeidbar. Mit der seit den Landtagswahlen von 1967 im Landtag vertretenen NPD trat überdies ein weiterer Akteur in das politische Kräftespiel ein. Das verfassungsrechtliche Problem bestand darin, dass der Ministerpräsident die der CDU angehörenden Minister nur mit Zustimmung des Landtags entlassen konnte, hierfür aber die notwendige Mehrheit fehlte, die Kräfteverhältnisse im Landtag andererseits kein konstruktives Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten zuließen. Nachdem Art. 6 VNV in der Weise geändert wurde, dass die Wahlperiode im Falle der Auflösung des Landtags erst 60 Tage nach dem Beschluss endete, beschloss der Landtag seine Auflösung, wie dies in Art. 7 VNV vorgesehen war.
Als Indikator für die Bewährung der Verfassung mag angesehen werden, dass der 1955 eingerichtete Staatsgerichtshof, der erst zwei Jahre später seine Rechtsprechungstätigkeit aufnahm, nur selten angerufen wurde. Seine erste Entscheidung allerdings führte sogleich zu einer Verfassungsänderung. Ebenso wie das Grundgesetz und die Verfassungen der anderen Bundesländer begründete die Vorläufige Niedersächsische Verfassung ein Zutrittsrecht der Landesregierung zum Landtag und seinen Ausschüssen. Durch eine Bestimmung der Geschäftsordnung wurden hiervon die Untersuchungsausschüsse und der Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Staatsgerichtshofs ausgenommen. Hiergegen rief die Landesregierung den Staatsgerichtshof an, der die entsprechende Vorschrift der Geschäftsordnung für unvereinbar mit Art. 10 VNV erklärte. Daraufhin ergänzte der Landtag die Verfassung dahingehend, dass das Zutrittsrecht nicht für Sitzungen der Untersuchungsausschüsse, des Wahlprüfungsausschusses und des Ausschusses zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Staatsgerichtshofs gelte.
Nach Art. 61 sollte die Vorläufige Verfassung ein Jahr nach Ablauf des Tages außer Kraft treten, an dem das deutsche Volk in freier Entscheidung eine Verfassung beschloss. Das rechtliche Schicksal der Landesverfassung war somit mit dem der Bundesverfassung verbunden. Da die Vereinigung Deutschlands durch den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik und nicht durch Neuschöpfung einer gesamtdeutschen Verfassung erfolgte, trat die Beendigung der Geltung der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung nicht gemäß Art. 61 VNV ein. Allerdings verlor ihre „Vorläufigkeit“ mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten ihre Berechtigung, so dass eine Revision geboten war. Die Fraktion der FDP im Niedersächsischen Landtag stellte bereits am 12. Juli 1990 den Antrag zur Erarbeitung einer neuen Niedersächsischen Landesverfassung eine Enquete-Kommission einzurichten. Dieser Antrag wurde auf der 5. Plenarsitzung vom 13. September 1990 behandelt, bei der sich in der Grundsatzfrage ein Konsens zwischen den Fraktionen abzeichnete. Auf Empfehlung des Ältestenrats beschloss der Landtag am 10. Oktober 1990 die Einsetzung eines Sonderausschusses „Niedersächsische Verfassung“, der 17 Mitglieder umfasste und den Auftrag erhielt, Vorschläge zur Änderung der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung mit dem Ziel der Schaffung einer endgültigen Niedersächsischen Verfassung zu erarbeiten. Der Sonderausschuss setzte sich aus acht Mitgliedern der SPD, sieben der CDU und jeweils einem Mitglied der Grünen und der FDP zusammen. Vorsitzender war der CDU-Abgeordnete Dr. Edzard Blanke, Stellvertreter der Abgeordnete Peter Rabe (SPD).
Der Sonderausschuss konstituierte sich auf seiner Sitzung vom 28. November 1990 und hielt in seiner zweieinhalbjährigen Tätigkeit insgesamt 44 Sitzungen ab. Ihm lagen ein Gemeinsamer Verfassungentwurf von SPD und Grünen, ein Gesetzentwurf der CDU zur Änderung der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung und ein Verfassungsentwurf der Fraktion der FDP vor. Die letzte Sitzung fand am 12. Mai 1993 statt. Am 13. Mai 1993 wurde die Niedersächsische Verfassung im Landtag mit 149 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme angenommen. Sie wurde am 19. Mai 1993 ausgefertigt und verkündet und trat am 1. Juni 1993 in Kraft.
Die „neue“ Niedersächsische Verfassung von 1993 ist verfassungsrechtlich keine Verfassungsneuschöpfung, die auf die verfassunggebende Gewalt des Volks zurückzuführen wäre. Sie ist – trotz aller weitreichenden Änderungen der „Vorläufigen“ Verfassung – bewusst im Verfahren der Verfassungsänderung beschlossen worden. So findet sich im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt vom 26. Mai 1993 der folgende Einleitungssatz: „Der Niedersächsische Landtag hat unter Einhaltung der Vorschrift des Art. 38 der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung die folgende Verfassung beschlossen, die hiermit verkündet wird.“
Da Art. 37 VNV – in Anlehnung an Art. 79 Abs. 3 GG – lediglich Verfassungsänderungen ausschloss, die den in Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 niedergelegten Grundsätzen widersprachen, konnte das Verfahren der Verfassungsänderung auch für eine Revision in Anspruch genommen werden, deren Ergebnis eine „neue“ Verfassung war.
Die Niedersächsische Verfassung vom 13. Mai 1993 ist im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin eine „Vollverfassung“. Das will heißen, dass auch die grundlegenden Beziehungen zwischen Staat und Bürgern in Gestalt von Grundrechten Bestandteile der Verfassung sind. Niedersachsen bedient sich hierbei des Modells der Inkorporation, in dem die im Grundgesetz festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte zum Bestandteil der Verfassung erklärt werden. Dieses auch von anderen Landesverfassungen genutzte Modell hat den Vorzug, dass die seinerzeit mehr als 40jährigen Erfahrungen mit dem Grundrechtskatalog und die hierzu ergangene Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für die Landesverfassung dienstbar gemacht werden konnten. Neben den Grundrechten des Grundgesetzes enthält die Niedersächsische Verfassung auch eigene Grundrechte sowie Staatszielbestimmungen, die mit Grundrechten in einem thematischen Zusammenhang stehen.
Neu in die Niedersächsische Verfassung aufgenommen wurden plebiszitäre Institute, nämlich die Volksinitiative, das Volksbegehren und der Volksentscheid. Bemerkenswert war, dass alsbald nach Inkrafttreten der Verfassung sich eine Volksinitiative „Gott in der Präambel“ formierte. Der Sonderausschuss hatte wegen bestehender Differenzen beschlossen, auf eine Präambel und damit auch auf eine „invocatiodei“ zu verzichten und die in ihr vorgesehenen anderen Teilen in Art. 1 aufgenommen. In dieser Fassung war die Verfassung vom Landtag beschlossen worden. Die Volksinitiative zielte auf eine Präambel mit ausdrücklicher Anrufung Gottes ab und konnte zu Beginn des Jahres 1994 eine beträchtliche Anzahl von unterstützenden Unterschriften sammeln. Die CDU-Fraktion im Landtag nahm sich der Initiative an und brachte einen entsprechenden Gesetzentwurf ein, aufgrund dessen die Präambel in ihrer geltenden Fassung eingefügt worden ist.
Durch die neue Niedersächsische Verfassung wurden die vor dem Staatsgerichtshof statthaften Verfahrensarten erweitert. Neben den Streitigkeiten über die Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren oder Volksentscheiden wurde die Verfassungsbeschwerde von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung durch ein Landesgesetz eingeführt. Da mit der Einführung der kommunalen Verfassungsbeschwerde die Subsidiaritätsklausel des Grundgesetzes eingriff, konnte fernerhin gegen Landesgesetze nur der Staatsgerichtshof angerufen werden. Nach einem jahrelangem „Dornröschen-Schlaf“ des Staatsgerichtshofs führte die Einführung dieser Verfahrensart zu vermehrter Rechtsprechungstätigkeit und hat – insbesondere auf dem Gebiet des Finanzausgleichsrechts – zu mehreren grundlegenden Entscheidungen des Staatsgerichtshofs geführt.
Durch das schon erwähnte Gesetz vom 6. Juni 1994 wurde der Niedersächsischen Verfassung eine Präambel mit der „invocatiodei“ vorangestellt. Drei Jahre später wurde ein Diskriminierungsverbot eingefügt, der Artikel über Kunst, Kultur und Sport neu gefasst sowie ein solcher über Arbeit und Wohnen und Tierschutz eingefügt. Überdies wurde die Anhörung der kommunalen Spitzenverbände durch Ergänzung des Art. 57 verfassungsrechtlich gewährleistet. Durch ein weiteres Änderungsgesetz wurde das Konnexitätsprinzip für die Übertragung von Aufgaben auf Kommunen bzw. die Begründung kommunaler Pflichtaufgaben aufgenommen und eine Rückgriffsmöglichkeit des Landes gegenüber Kommunen begründet. Mit dem Änderungsgesetz von 2009 wurde eine Bestimmung eingefügt, die einen besonderen Schutz von Kindern und Jugendlichen zum Inhalt hat.
Ich komme zum Schluss. 60 Jahre nach Inkrafttreten der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung und damit nach sechs Jahrzehnten der Geltung einer Niedersächsischen Verfassung, die diesen Begriff verdient, lässt sich sowohl eine Bilanz ziehen wie ein Ausblick wagen. Aus bescheidenen Anfängen eines „Organisationsstatuts“, das den unitarischen Tendenzen der Bundesverfassung und der seinerzeit herrschenden Auffassung in der Staatsrechtslehre entgegenkam, hat sich in Niedersachsen eine Verfassung entwickelt, die der Staatsqualität des Landes Rechnung trägt, aber nicht zu Überspitzungen der Eigenstaatlichkeit tendiert. Insbesondere durch die Einführung plebizitärer Institute ist die Niedersächsische Verfassung ein Stück weit aus dem Schatten des Grundgesetzes herausgetreten. Zwar ist die Bundesverfassung – wie Herr Kollege Huber dargestellt hat – auch für die Bundesländer die überwölbende Verfassungsordnung und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts prägend. Allerdings ist der Niedersächsische Staatsgerichtshof im Einzelfall auch eigenständige Wege bei der Auslegung der Verfassung gegangen.
Der Einfluss einer Verfassung auf den Zustand eines Gemeinwesens sollte nicht überschätzt werden, weil jedes Gemeinwesen letztlich von der Fähigkeit seiner Amtsträger zu gemeinwohlbezogenem Handeln, ihrer Anerkennung durch die Bürger und dem bürgerschaftlichen Engagement lebt. Rechtsnormen – auch Verfassungsnormen – können solches Handeln anregen, legitimieren – auch begrenzen -, aber nicht erzeugen. Der viel zitierte „Verfassungspatriotismus“ konnte nur als Metapher verstanden werden, denn es ist schwerlich denkbar, dass Menschen für eine Verfassung eintreten und sie hoch schätzen, sich dem Gemeinwesen gegenüber aber indifferent zu verhalten, das durch sie „verfasst“ wird. So ist der Tag, an dem der 60jährigen Geltung der Niedersächsischen Verfassung gedacht wird, auch ein Gedenktag für das von ihr verfasste Gemeinwesen, das – sieht man einmal von tagesaktuellen Fragen ab – zweifelsfrei in guter Verfassung ist.